Ob in Restaurants, Großraumbüros oder Schulen – in unserem Alltag sind wir mit lauten Geräuschkulissen konfrontiert. Diese Lärmbelastung kann Stress auslösen und die Gesundheit schädigen. Um Lärm zu reduzieren, kommen schallabsorbierende Materialien zum Einsatz. Derzeit arbeiten Wissenschaftler an den DITF an einem umfassenden System zur Messung und Vorhersage der akustischen Eigenschaften verschiedenster Textilien. Ziel der Forschung ist es, eine breite Vielfalt an schallabsorbierenden oder akustisch wirksamen Materialien zu entwickeln.
Gestricke und Webwaren bieten Vorteil
Aktuell werden neben Schaumstoffen größtenteils Vliesstoffe als Schallabsorber eingesetzt. Diese sind allerdings verhältnismäßig dick und schlecht dehnbar. Gestrickte oder gewebte Textilien sind elastischer und flexibler und sind in der Lage, Lärm gezielter in bestimmten Frequenzbereichen zu reduzieren. Dadurch können sie individuell an existierende oder erwartete Lärmprobleme angepasst werden. Allerdings werden diese textilen Flächen bisher in der Akustik selten angewendet. „In der Akustikforschung herrscht ein eingeschränktes Wissen über das Potential und die Vielfalt von Textilien. Als Textilforschungsinstitut möchten wir dafür sorgen, dass eine große Bandbreite an flächigen Textilien, zum Beispiel auch 3D-Textilien, Einzug in die Akustikwelt hält. Dafür schaffen wir die nötigen Grundlagen,“ erklärt Dr. Elena Shabalina, Leiterin des Technologiezentrums E-Textiles & Akustik an den DITF.
Messprobleme verschenken Potential
Um dieses Potential nutzbar zu machen, stoßen Forschung und Entwicklung auf ein Problem: Die für Vliesstoffe eingesetzten Messverfahren und Simulationsmodelle sind nicht ohne Weiteres für andere Arten von Textilien geeignet. Vliesstoffe bestehen aus zufällig angeordneten, miteinander verbundenen Fasern, sie verfügen über eine sogenannte Wirrfaseranordnung. Bei Geweben und Strickstoffen weist die Faseranordnung hingegen ein wiederkehrendes, nicht-zufälliges Muster auf. Das bewirkt große Unterschiede in den Materialeigenschaften. Aufgrund mangelnder Alternativen müssen Hersteller gestrickter oder gewebter akustischer Textilien trotzdem diese eingeschränkt geeigneten Methoden für ihre Produktentwicklung verwenden.
Modellrechnungen für optimale Produktentwicklung
An diesem Punkt setzt das DITF-Forschungsprojekt an. Die Forschenden entwickeln neue akustische Messverfahren und Vorhersagemethoden mit denen bewertet werden kann, wie verschiedene Textilien mit Schall interagieren, ob sie ihn absorbieren, reflektieren oder streuen. Mithilfe mathematischer Modelle können textile Materialien bereits in der Designphase auf ihre akustische Wirkung hin überprüft, angepasst und optimiert werden.
Die Projektergebnisse werden Unternehmen dabei unterstützen, ihre Produktentwicklungsprozesse effizienter zu gestalten und die Materialien gezielter auszulegen, zum Beispiel nachhaltig zu gestalten. Auf diese Weise werden Markteinführungszeiten verkürzt.
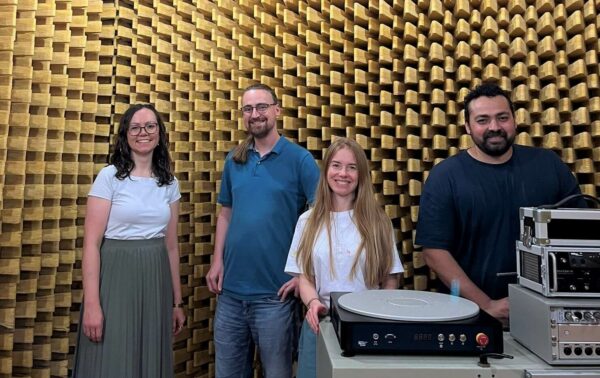
Akustik-Team des Technologiezentrums E-Textiles & Akustik im Schallmessraum der DITF. Von links nach rechts: Luisa Euler, Tobias Hecht, Elena Shabalina, Ahmed Mehrem. Foto: DITF
DITF stellt Akustiklabor für Industrieversuche zur Verfügung
Ergänzend zu der Entwicklung neuer Messmethoden wird das Akustiklabor an den DITF ausgebaut. Der Messraum mit schallabsorbierenden Wänden und schallreflektierendem Boden (Halbfreifeldraum) wird mit einem modernen Datenerfassungssystem ausgestattet. Dazu zählen neben Software verschiedene Messmikrofone, Lautsprecher und ein Drehteller, um die Klangqualität von Lautsprechern aus verschiedenen Richtungen zu vermessen. Das neue Akustiklabor wird sowohl im Institut für die Forschung verwendet als auch der Industrie für Versuche zur Verfügung gestellt werden.
Das Forschungsprojekt MetAkusTex wurde im Rahmen des Programmes Invest BW – Praxissprints durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.
Kontakt:
Dr. rer. nat. Elena Shabalina, DITF
E-Mail: elena.shabalina@ditf.de
 Kommerzielle schallabsorbierende Vliesstoffe. Foto: DITF
Kommerzielle schallabsorbierende Vliesstoffe. Foto: DITF